Die Dörfer, die nicht sterben wollen
Die Dörfer, die nicht sterben wollenKleine Gemeinden in ganz Österreich leiden unter der Verödung ihrer Ortskerne. Wie können sie wiederbelebt werden?
Von Markus Hagspiel
Bürgermeister Christoph Windisch: „Wir erhoffen uns eine Belebung des Ortskernes"
Amtsleiterin Regina Lacher-Specht: „Wir freuen uns sehr über den Dorftreff"
Ein Blick auf die Zahlen
„Nicht jede Gemeinde muss größer werden. Vielmehr müssen sie sich überlegen, wie sie sich entwickeln wollen”, sagt Raumplanerin Stumfol. Ein Allheilmittel gegen aussterbende Ortskerne gibt es nicht. Gemeinden müssen die Situation vor Ort analysieren und passende Lösungen für ihre lokalen Probleme entwickeln. “Es braucht jedenfalls sogenannte dritte Orte, wo sich die Menschen treffen können”, sagt Stumfol.














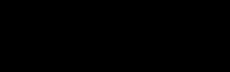














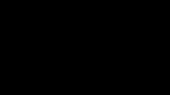

 Die Dörfer, die nicht sterben wollen
Die Dörfer, die nicht sterben wollen
 Mannsdorf an der Donau
Mannsdorf an der Donau
 Das neue Gemeindehaus
Das neue Gemeindehaus
 Kritik am Vorhaben
Kritik am Vorhaben
 Das alte Gemeindehaus
Das alte Gemeindehaus
 Leerstand im Ort
Leerstand im Ort
 Bodenversiegelung
Bodenversiegelung
 Bürgermeister Christoph Windisch: „Wir erhoffen uns eine Belebung des Ortskernes"
Bürgermeister Christoph Windisch: „Wir erhoffen uns eine Belebung des Ortskernes"
 Das geschlossene Wirtshaus
Das geschlossene Wirtshaus
 Der Dorftreff in Stössing
Der Dorftreff in Stössing
 Dorftreff wird angenommen
Dorftreff wird angenommen
 Einkaufen im Dorftreff
Einkaufen im Dorftreff
 Amtsleiterin Regina Lacher-Specht: „Wir freuen uns sehr über den Dorftreff"
Amtsleiterin Regina Lacher-Specht: „Wir freuen uns sehr über den Dorftreff"
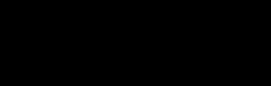 Ein Blick auf die Zahlen
Ein Blick auf die Zahlen
 Die politische Komponente
Die politische Komponente