75 Jahre DIE FURCHE
Strömung
Wie finden sich Antworten jenseits des Mainstreams? Wann bringt einen die Strömung voran? Wann wird sie gefährlich? Michael Blume über Verschwörungsmythen, eine diskursive Donaufahrt mit dem Liedermacher Hubert von Goisern, Theresia Heimerl über „Das Unsagbare“, Margit Körbel über antifeministische Frauen und Reinhard Seiß über den Trend zur architektonischen Hässlichkeit.
Koordinaten
Wie ist die Lage? Haben sich die Festlegungen verschoben? Bundespräsident Alexander Van der Bellen im großen FURCHE-Interview, Martin Selmayr über das Verhältnis zwischen Nationalstaaten und EU, Sarah Spiekermann über das Leben nach Corona, Manfred Prisching über die polarisierte Welt, Regina Polak und Rudolf Mitlöhner über Links-Rechts-Verschiebungen und Otto Friedrich über Religionsjournalismus.
Fahrrinnen
Welche Wege sind schiffbar? Welche Passage ist möglich? Gibt es Alternativen? Otto Friedrich bat Muslimin Amina Harambašić und den Juden Yuval Katz-Wilfing zum interreligiösen Gespräch, Daniel Jurjew schreibt über die Möglichkeit ,die Fahrrinnen der Sprache zu wechseln, Khaled Hakami denkt nach über „WEIRD-People“ und Manuela Tomic über Identität als persönliches Versteckspiel.
Untiefen
Was lauert unter dem Wasser? Wo droht man aufzulaufen? Thomas Stangl über Abgründe und Seichtigkeit, Hildegund Keul über das Potenzial der Verwundbarkeit, Vanessa Spanbauer über Nachwirkungen von #BlackLivesMatter, Peter Huemer über (un)verschämten Antisemitismus, ein Porträt eines Seenotretters, Matthias Greuling über Flucht im heimischen Film sowie ein Brief über das Hinnehmen von Brigitte Quint.
Ankerplatz
Welchen Hafen anlaufen? Wo ankern, Ruhe finden? Oliver Tanzer über den Zwiespalt, den Häfen und Ankerplätze auslösen, Erhard Busek über Heimat als innere Anlegestelle, eine Ordensfrau und ein Psychologe im Gespräch über Vertrauen, Katharina Tiwald über den Ankerplatz Schule, Reporter Wolfgang Machreich über Natur und Bewegung als Kraftquelle und Philosoph Martin Poltrum über Geisteswissenschaften als letzte Bastion.
Leuchtfeuer
Was begleitet unterwegs? Welche Visionen locken? Gespräch mit dem Theologen Jürgen Manemann zur Zukunft des Christentums, Tobias Müller über Klima-Lichtblicke, Martin Tauss über den Geist als Gut, Ulrike Guérot über Europa, FURCHE-Herausgeber Wilfried Stadler über ökonomische Weichen, Fritz Hausjell über die Zeitung als Leuchtturm, Quantenphysiker Anton Zeilinger im Interview sowie eine kulturelle Ansage von Brigitte Schwens-Harrant.
Segel setzenHorizonte eröffnen und Orientierung bieten: Das ist der Anspruch der FURCHE seit 1945. Nun, in stürmischer Zeit, wird sie zur Seekarte – und verzeichnet Koordinaten, Strömungen, Fahrrinnen, Untiefen, Ankerplätze und Leuchtfeuer.
Leitartikel Die Kunst des Unmöglichen Tiefgang und Weitblick: An diesen Ansprüchen orientiert sich die FURCHE seit 75 Jahren. Oft totgesagt, ist sie immer wieder neu aufgebrochen. Zum Jubiläum eines Solitärs.
Leitartikel Die Kunst des Unmöglichen Tiefgang und Weitblick: An diesen Ansprüchen orientiert sich die FURCHE seit 75 Jahren. Oft totgesagt, ist sie immer wieder neu aufgebrochen. Zum Jubiläum eines Solitärs.

Fiebrige geistige Unruhe“: Mit diesen Worten beschrieb der ehemalige Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Kurt Wimmer, in der 60-Jahr-Jubiläumsausgabe dieser Zeitung die besondere Stimmungslage des Jahres 1945. Krieg und eine totalitäre Ideologie hatten „die Hirne verwüstet, Moral zerstört und Humanität vernichtet“, wie es der Publizist und Historiker Friedrich Heer damals empfand. Zugleich gab es „echten Enthusiasmus, Ergriffenheit und den Willen, alle Impulse aufzunehmen, die man erhalten konnte.“
Mitten in dieser Zeit der Unruhe, des Aufbruchs, aber auch und besonders des Mangels wagte der damals bereits 73-jährige Friedrich Funder schier Unmögliches: Der ehemalige Chefredakteur der christlichsozialen Reichspost und Scharfmacher, der durch den „Geist der Lagerstraße“ im Dachau geläutert worden war, gründete ein neues Wochenblatt, eine "kulturpolitische Wochenschrift": die FURCHE.
Erstmals erschienen am 1. Dezember 1945, sollte sie ein Beitrag zum geistigen Wiederaufbau sein, gleichsam eine Furche durch den von Krieg und Verheerung verhärteten Ackerboden ziehen. Ein "hohes geistiges Forum" sollte diese Zeitung werden - getragen vom Geist der Versöhnung. Dass dies gelingen konnte, ging wesentlich auf Friedrich Heer zurück, den Funder 1949 in die FURCHE-Redaktion holte: Dessen Vision vom „Gespräch der Feinde“ sollte seine Zeit und auch diese Zeitung nachhaltig prägen.
Heutige Zumutungen
Heute, 75 Jahre später, klingen die Texte von damals sprachlich oftmals fremd, ja verstörend. Ihr zentraler Gehalt ist aber von bleibender Relevanz – auch und gerade anno 2020, in einem Jahr der Krisen und des chronischen Ausnahmezustands.
Die „fiebrige geistige Unruhe“ von heute ist Folge multipler Zumutungen und Überforderungen: Klimakatastrophe, Terror und ein Virus rütteln am kollektiven Nervenkostüm und an traditionellen Vorstellungen von Freiheit, Autonomie und Demokratie. Befürworter und Gegner politisch dekretierter Maßnahmen stehen einander zunehmend verständnislos, ja feindselig gegenüber. In dieser Situation erhält auch das „Gespräch der Feinde“, die Auseinandersetzung mit dem Fremden, Verstörenden, Abgelehnten, wieder neue Aktualität.
So „unmöglich“ dies oftmals scheint, so „unmöglich“ klingt auch die nunmehr 75-jährige Geschichte dieser Zeitung, die unablässig für das Gespräch, den Dialog und das Aufeinanderzugehen wirbt.
„Sieben Leben“ habe die FURCHE, heißt es gern, und tatsächlich war diese Zeitung mehr als einmal in ihrer Existenz bedroht. Auch Richtungskämpfe prägten ihre Geschichte: Nachdem man die weltoffene und durchaus auch kirchenkritische Redaktion 1967 wieder „auf Kurs“ bringen wollte, prägte die damalige FURCHE-Redakteurin und spätere ORF-Journalistin Trautl Brandstaller das Bild von der „zugepflügten FURCHE“.
Sie ist freilich wieder aufgebrochen worden – und sie bricht selbst immer wieder auf in neues, ungewisses Terrain: Zuletzt 2019 in die digitale Welt mit einem einzigartigen Projekt, dem FURCHE-Navigator. Der besondere Schatz der FURCHE, ihr Archiv mit zeithistorisch bedeutenden Beiträgen namhafter Autorinnen und Autoren – wurde gehoben, alle Beiträge bis zurück ins Jahr 1945 wurden digitalisiert und mittels künstlicher Intelligenz miteinander in Verbindung gebracht.
Ab Jänner 2021 werden sie in Zehnjahresschritten auf furche.at zugänglich gemacht. Es ist ein technologisch innovativer Weg, dem hohen Anspruch zu entsprechen, den diese Zeitung seit Anbeginn an sich selber stellt: ihren Leserinnen und Lesern Tiefgang und Weitblick zu bieten, in einer komplexen Welt ein wenig Orientierung zu geben und neue Horizonte zu eröffnen.
Nun, mit dieser Sonderausgabe zum 75-Jahr-Jubiläum, greifen wir die Metaphorik des Navigators auf und treiben sie - analog wie digital - nochmals weiter: Die FURCHE wird zur Seekarte und verzeichnet die wesentlichen Koordinaten, Strömungen, Fahrrinnen, Untiefen, Ankerplätze und Leuchtfeuer unserer Zeit.
Den Auftakt markiert ein großes Interview mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Es ist eine österreichische Standortbestimmung, die auf die Illusion von Österreich als „Insel der Seligen“ ebenso eingeht wie auf die Schwierigkeit, dieses Land und seine Politik im Europa von heute kartographisch zu verorten.
Ergänzend zu den weiteren Beiträgen präsentieren wir sechs bedeutende historische Texte aus der FURCHE-Geschichte: vom Essay des Gründers Friedrich Funder bis zu einem literarischen Text der großen Jeannie Ebner. Spannendes gibt es auch aus der Digitalredaktion: Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Geschichten der Jubelnummer multimedial aufbereitet; und auf furche.at/podcast gibt es zu jedem Seekarten-Begriff eine eigene Podcast-Folge.
Werteorientierung und Weltoffenheit
In diesen Podcasts wird den Interviewpartner(inne)n dieser Jubiläumsausgabe eine zentrale Frage gestellt: „Was gibt Ihnen Orientierung?“ Sie führt zurück zu dem, wofür die FURCHE seit 1945 steht: für einen von Werteorientierung und Weltoffenheit geprägten Qualitätsjournalismus – und für das Bemühen um einen wertschätzenden Diskurs in Zeiten der Polarisierung. Intellektuelle Tiefe, diskursive Breite, ein Sensorium für existenzielle Fragen und eine klare Haltung, wenn es um Menschenwürde, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit geht: An diesen – zugegeben anspruchsvollen – Koordinaten richtet sich die FURCHE immer wieder aus.
Die FURCHE, das sind freilich immer die Menschen, die dahinter stehen und die Ansprüche an diese Zeitung hoch halten. Ohne dieses einzigartige Team wäre das „unmögliche“ Projekt FURCHE vollends undenkbar. Mein Dank gilt an dieser Stelle allen, die seit Monaten neben den regulären Ausgaben mit vollem Einsatz an dieser besonderen Jubiläumsnummer arbeiten – analog wie digital.
In besonderer Weise danken möchte ich Nicole Schwarzenbrunner, die als Geschäftsführerin die Idee zum Navigator hatte und die FURCHE mit großer strategischer Weitsicht in die digitale Zukunft steuert. Ebenfalls bedankt seien unsere Herausgeber Heinz Nußbaumer und Wilfried Stadler, die uns wesentlich unterstützen – sowie Markus Mair, der als Vorsitzender der Styria Media Group nachhaltig an das Gelingen dieser Expedition glaubt.
„Fiebrige geistige Unruhe“: Dieses Gefühl von 1945 wird uns noch weiter begleiten. Bleiben Sie gesund – und bleiben Sie an Bord.

Ein Schatz aus 75 Jahren Von Markus Mair
Ein Schatz aus 75 Jahren Von Markus Mair

Denn Presse- und Meinungsvielfalt sind zwei unverzichtbare Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie. Als Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit ist sie nicht vom Himmel gefallen. Sie ist das Ergebnis eines langwierigen, widersprüchlichen, zur Zukunft hin offenen Prozesses. Und sie ist schon gar nichts Selbstverständliches, wie wir in diesen Tagen wieder neu erkennen müssen.
Auch anno 2020. Die FURCHE feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Das ist einem hervorragenden Team – durch all die Jahre hindurch – zu verdanken, einem nahezu seismografischen Gespür für das, was sonst oft im Verborgenen bleibt: In der FURCHE taucht das auf, was im raschen Mediengeschehen für gewöhnlich untergeht. Die FURCHE kommt unbeirrbar ihrer Aufgabe als unabhängiges Medium in jeder Zeile nach – in Print und Digital, auch im einzigartigen Angebot des Navigators, der uns durch manche komplizierten Diskurse führt, indem er durch die Entwicklung einer gesellschaftlichen Diskussion geleitet, durch die Genese von Begriffen im Laufe der (FURCHE-)Geschichte.
Wir halten heute einen Schatz in unseren Händen. Einen Schatz aus 75 Jahren. Die FURCHE ebnet Wege hin zur persönlichen und gesellschaftlichen Horizonterweiterung. Mit einem Team, dessen vielseitige Kompetenzen gerade in der jüngsten Zeit auch außerhalb der FURCHE und der Styria Media Group ihre zusätzlichen Plattformen finden. Dieser Schatz ist für uns als Styria von großer Bedeutung. Weil wir wissen, wie wertvoll er für die Gesellschaft ist. Weil wir wissen, dass wir damit einen unbestechlichen Beitrag für die Demokratie leisten, Woche für Woche aufs Neue in Print, täglich auf den Social-Media-Kanälen der FURCHE und ständig verfügbar im digitalen Navigator, der uns durch weite Themengebiete führt und die Augen öffnet für neue Zusammenhänge.
Denn eines wird immer bleiben: Das urmenschliche Bedürfnis, zu verstehen und dadurch erst handlungsfähig zu sein. Dazu braucht es verlässliche Information aus seriösen Quellen, die Meinungsvielfalt zulassen und fördern. All das ist natürlich auch gut für eine Medienmarke, gut für die Gesellschaft und unverzichtbar für die Demokratie. Genau das brauchen wir jetzt, vielleicht mehr denn je.
In diesem Sinne: Tauchen Sie ein in die Jubiläumsausgabe und alle weiteren Ausgaben der FURCHE, lassen Sie sich informieren, inspirieren und mitunter auch irritieren! Das tut der eigenen Meinungsbildung gut. Und dem Team der FURCHE von Herzen alles Gute zu diesem Jubiläum und vielen Dank für alles, was ihr leistet – in der Vergangenheit, anno 2020 und in Zukunft! Ihr könnt stolz auf euch sein.

Koordinaten
KoordinatenWie ist die Lage? Haben sich die Festlegungen verschoben?

Alexander Van der Bellen im Interview
PolitikVan der Bellen: "Nerven bewahren!"1944, ein Jahr vor Gründung der FURCHE, wurde Alexander Van der Bellen geboren. Ein telefonischer Rück-, Rund- und Ausblick mit dem Bundespräsidenten.
"Haben Sie nicht mit der FURCHE ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich? Wer kann Ihnen ernsthaft Konkurrenz machen? Das stimmt mich optimistisch."Alexander Van der Bellen
Liebe Leserin, lieber Leser,
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Was gibt Ihnen Orientierung?Alexander Van der Bellen
"Einmal hat mich eine Botschafterin gefragt: ,Please, explain Austria to me!‘ Und ich habe geantwortet: ,The first thing you have to understand is: Austria is not Germany!"Alexander Van der Bellen
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Tandem für Europa
InternationalEin Tandem für EuropaEU und Nationalstaaten sind kein Gegensatzpaar. Im Gegenteil, Corona und die anderen Herausforderungen unserer Zeit können nur gemeinsam überwunden werden. Denn ein starkes Europa stärkt auch die europäischen Mitgliedsländer.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Martin Selmayr.
Die Krise als Wahrheitsmoment
PhilosophieDie Krise als WahrheitsmomentCorona stellt das Wirtschaftssystem und unseren Lebenswandel auf den Prüfstand. Die Diskussion über künftige Kursveränderungen muss von einer gewichtigen Frage ausgehen: Was ist von Wert?
Weiterlesen: Zum vollständigen Artikel von Sarah Spiekermann-Hoff.
Polarisierte Welt
GesellschaftDie polarisierte WeltVor 75 Jahren erstand Österreich aus einer tief gespaltenen Gesellschaft. Wo finden sich die Fragmentierungen und Polarisierungen der spätmodernen Gegenwart? Ein Essay.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Manfred Prisching.
Verschobene Koordinaten
GesellschaftHaben sich die Koordinaten verschoben?Die „Mitte“ reklamieren viele für sich. Doch wo ist sie zu verorten? Und: Haben sich die Wahrnehmungen dessen, was als „links“ oder „rechts“ gilt, im öffentlichen Diskurs verändert? Eine Mail-Kontroverse zwischen dem ehemaligen FURCHE- Chefredakteur Rudolf Mitlöhner und der Pastoraltheologin Regina Polak.
Haben sich die Koordinaten verschoben?Regina Polak
Liebe Leserin, lieber Leser,
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Haben sich die Koordinaten verschoben?Rudolf Mitlöhner
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Religionsjournalismus
MedienReligionsjournalismus: Wider religiösen AnalphabetismusDie FURCHE hat ein eigenes Religionsressort – denn: Religion ist eine öffentliche Sache, die der Wahrnehmung gerade durch den Journalismus bedarf. Versuch einer Standortbestimmung.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Otto Friedrich.
Strömung
StrömungWie finden sich Antworten jenseits des Mainstreams? Wann bringt einen die Strömung voran? Wann wird sie gefährlich?

Verschwörungsmythen
GesellschaftVerschwörungmythen: Altes MisstrauenWarum Verschwörungsmythen so verbreitet sind und was man gegen sie (nicht) tun kann: Analyse einer globalen und brandgefährlichen gesellschaftlichen Strömung.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Michael Blume.
Mit Hubi auf der Donau
GesellschaftGegen den StromKamingespräch an Bord. Die FURCHE steigt mit Hubert Achleitner - alias Hubert von Goisern - auf ein Schiff und fährt Donau aufwärts. Eine diskursive Exkursion jenseits des Mainstreams.
Liebe Leserin, lieber Leser,
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Wie entsteht eine Strömung?Exkurs ins Ruderhaus von Kapitän Markus Luger
"Mit dem Strom gehen heißt an Niveau zu verlieren.""Gegen den Strom gehen heißt, an Höhe zu gewinnen. Ein Prinzip aus der Nautik, das man auch metaphorisch sehen kann."
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Das Unsagbare
GesellschaftGefährliche Unterströmung: Das UnsagbareIm Meer der Sprache ist das, was nicht gesagt werden kann, eine anthropologische Konstante. Eine Navigationshilfe anhand von Körpern, Göttern, Sirenen und anderen Ungeheuern.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Theresia Heimerl.
Antifeministische Frauen
GesellschaftFrauen in antifeministischen Strömungen

GesellschaftTraditionelle Frauen im antifeministischen BacklashFeminist(inn)en haben lange dafür gekämpft, dass Frauen nicht nur die Rolle der Hausfrau und Mutter zusteht. Nun scheint es einen Backlash zu geben: Vermehrt tauchen junge Frauen auf, die genau diese propagieren.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Margit Körbel.
Gesellschaft"Machtgewinn durch Selbsterhöhung"Feministische Ideen in einer vermeintlich gleichberechtigten Gesellschaft zu vermitteln, birgt zahlreiche Herausforderungen. Vor allem, wenn antifeministische Strömungen dagegen wettern. Ein Gespräch mit der Genderforscherin, Politikwissenschafterin und Rechtsextremismusexpertin Judith Goetz.
Was verbinden Frauen mit Feminismus?Edith59, pensionierte Logopädin
Hat Feminismus den Anschluss zur Realität verloren?Judith Goetz, Genderforscherin
Liebe Leserin, lieber Leser,
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Was verbinden Frauen mit Feminismus?Bianca36, Angestellte in Karenz
Was verbinden Frauen mit Feminismus?Jutta51, Hausfrau
Hausfrau versus KarrierefrauZwei Seiten eines Problems
Was verbinden Frauen mit Feminismus?Katharina21, Studentin
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Bau-Kulturnation Österreich?
ArchitekturBau-Kulturnation Österreich?Wenn Architektur und Städtebau ein Spiegel der Gesellschaft sind, dann stellen sie unserer momentanen kulturellen Verfasstheit ein verheerendes Zeugnis aus.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Reinhard Seiß.
Fahrrinnen
FahrrinnenWelche Wege sind schiffbar? Welche Passage ist möglich? Gibt es Alter- nativen?

Der mögliche Dialog
ReligionJuden und Muslime: Der mögliche DialogEin Gespräch zwischen Christen und Juden sowie zwischen Christen und Muslimen findet hierzulande statt. Wie steht es aber um den Austausch zwischen Juden und Muslimen? Eine Gegenwarts- wie eine Zukunftsfrage.
Weiterlesen: Zum vollständigen Interview mit Amina Harambašić und Yuval Katz-Wilfing.
Fahrrinnen der Sprache: Übersetzen
LiteraturKommen ein Übersetzer, ein Löwe, ein Pudel und ein Philosoph in eine Bar …Was wüssten wir von anderen Kulturen, gäbe es die Übersetzer nicht. Schaffen sie billigen Abklatsch? Neue Kunst? Fenster in die Welt? Von der Schwierigkeit, die Fahrrinnen der Sprachen zu wechseln.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Daniel Jurjew.
WissenNicht alle sind WEIRDVor zehn Jahren erschütterte ein revolutionärer Begriff eine ganze Wissenschaft: die „WEIRD-People“. Was haben wir daraus gelernt?
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Khaled Hakami.
GesellschaftIdentität: Ein VersteckspielIdentität ist nur ein Wort, das klingt. Für unsere Autorin, die in den 1990er Jahren mit ihrer Familie vor dem Jugoslawien-Krieg geflüchtet ist, wurde das Wort zu einem Spiel.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Manuela Tomic.
Untiefen
UntiefenWas lauert unter dem Wasser? Wo droht man aufzulaufen?

Untiefen und Literatur
LiteraturIst das Schlamm? Oder lebt das?Untiefe bedeutet das Gegenteil von Tiefe, also Seichtheit; dennoch scheint eine Untiefe gefährlicher als jede Tiefe. Schriftsteller Thomas Stangl über Abgründe, Seichtigkeit – und die Literatur.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Thomas Stangl.
Chance der Verletzlichkeit
GesellschaftChance der VerletzlichkeitVulnerabel sein: Über das Aufleuchten eines Augenblicks, der dem Tod Trotz bietet. Nicht nur in der Theologie wächst die Erkenntnis, dass in der Verwundbarkeit destruktives wie schöpferisches Potenzial schlummert.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Hildegund Keul.
GesellschaftRassismus in Österreich nach #BLM„White Silence Is Violence“, „No justice, no peace“ und natürlich #BlackLivesMatter – kaum etwas bestimmte dieses Jahr abseits der Coronakrise so sehr wie die Anliegen der Anti-Rassismus-Bewegung. Was davon bleibt.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Vanessa Spanbauer.
Antisemitismus: Es ist nie ganz weg, was war
GesellschaftAntisemitismus: Es ist nie weg, was einmal warAuch nach der Schoa war der Judenhass im jüdisch-christlich geprägten Europa nie verschwunden. Heute offenbart er sich teilweise in neuem Gewand. Über verschämten und unverschämten Antisemitismus.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Peter Huemer.
Wo Europa wegschaut
PolitikWo Europa wegschautDer Religionslehrer Jakob Frühmann ließ sich beurlauben, um Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten. Früher hat das als heldenhaft gegolten, heute werden Seenotretter schikaniert und kriminalisiert.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Wolfang Machreich.
Unheilbare Wunden
FilmUnheilbare Wunden - Flucht und Vertreibung im österreichischen FilmVon Karl Breslauers Stummfilm „Die Stadt ohne Juden“ aus 1924 bis zu den aktuellen Flüchtlingskrisen: Wie Österreichs Film versucht, das Thema Flucht und Vertreibung begreifbar zu machen.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Matthias Greuling.
Was wir hinnehmen
GesellschaftWas wir hinnehmenGibt es Antworten auf Fragen, die noch nicht gestellt sind? Drei Frauen offenbaren einer Mutter ein gesellschaftliches Dilemma, vor dem sie ihr Kind nicht verschonen kann – und will. Ein Brief über das Hinnehmen.
lange wird es nicht mehr dauern und du wirst die Antworten, die ich dir anbiete, anzweifeln. Das hoffe ich zumindest. Denn dann bist du zu einem kritischen Geist geworden. Und das wünsche ich mir für dich. Gleichzeitig schmerzt der Gedanke, dass ich dich nicht vor der Erkenntnis werde bewahren können, dass in dieser Welt Unrecht geschieht Doch vielleicht findest du eines Tages Antworten auf Fragen, denen ich ratlos gegenüberstehe.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Brigitte Quint.
Ankerplatz
AnkerplatzWelchen Hafen anlaufen? Wo ankern, Ruhe finden?

Häfenelegie
InternationalHäfenelegieIn ihnen kulminieren Leben, Reichtum, Zivilisation. Ohne sie herrscht Isolation. Warum Diktatoren Hafenstädte hassen und Demokraten sie lieben. Eine Ortung.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Oliver Tanzer.
Erhard Busek: Heimat als Anker
GesellschaftErhard Busek: Heimat als AnkerKurs nehmen auf der Suche nach Orientierung. Weniger geografische Koordinaten, als geistige Verortungen sind dabei ausschlaggebend. Erhard Busek über Richtungsangaben und innere Anlegestellen.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Erhard Busek.
Vertrauen
GesellschaftKönnen wir noch vertrauen?Der Glaube an die Kontrollierbarkeit der Welt ist ins Wanken geraten. Umso wichtiger wäre Vertrauen als Anker. Was das bedeutet? Eine Ordensfrau und ein Psychologe im Gespräch.
Müssen Klienten Ihnen vertrauen?Georg Fraberger, Psychologe
Liebe Leserin, lieber Leser,
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
"Wenn man einem Kind etwas von vornherein nicht zutraut, dann kann es das meist auch nicht, dann zieht man ihm den Boden unter den Füßen weg."
Vertrauen in der SchuleSr. Beatrix Mayrhöfer
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Flirrendes schwebendes Kollektiv
BildungSchule: Ein flirrendes, schwebendes Kollektiv Guter Unterricht ist wie ein Konzert, in dem alle Instrumente zusammenspielen. Auch wenn die Violine quietscht, der Schlagzeuger zappelt, die Cellistin keine Noten lesen kann. Eine Komposition.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Katharina Tiwald.
Gehend, steigend, kletternd ankern
LebenskunstGehend, steigend, kletternd ankernDie Gebrüder Grimm haben es beschrieben, Viktor Frankl und die Ökomedizin geben ihnen recht: Natur und Bewegung schaffen Inseln der Askese und Refugien des Ausgleichs.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Wolfgang Machreich.
Die letzte Bastion
WissenGeisteswissenschaft: Die letzte Bastion250 Jahre nach Hegels Geburt sind die Geisteswissenschaften in Bedrängnis geraten. Doch gerade heute sind ihre Leistungen neu zu würdigen. Das zeigt sich sogar in Medizin und Psychotherapie.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Martin Poltrum.
Leuchtfeuer
LeuchtfeuerWas begleitet unterwegs? Welche Visionen locken?

Interview mit Jürgen Manemann
ReligionJürgen Manemann: "Weg mit dem Selbstmitleid!"Taugt Religion, das Christentum oder gar die Kirche als Leuchtturm für die Gesellschaft? Nach Überzeugung des Theologen und Philosophen Jürgen Manemann muss sich jedenfalls die institutionelle Form der Religion radikal verändern, will sie zukünftig Potenzial entwickeln.
Weiterlesen: Zum Interview mit Jürgen Manemann.
Die Natur ist der Schlüssel
InternationalDie Natur ist der SchlüsselUntergangsszenarien zum Thema Klimawandel gibt es genug, dachten sich niederländische Forscher. Also entwickelten sie eine Karte – und einen positiven Blick auf die Zukunft.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Tobias Müller.
WissenNach innen LeuchtenIm hektischen Prozess der Digitalisierung ist unser wertvollstes Gut in Gefahr: der menschliche Geist. Es braucht eine „Kultur des Bewusstseins“ – als Bollwerk, als Kompass, als Bereicherung.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Martin Tauss.
Die Vielfalt der Kulturen und das Sacre du Citoyen
PhilosophieEuropa: Die Vielfalt der Kulturen und das Sacre du CitoyenPopulisten und Nationalisten schüren Verlustängste und agieren gegen das Gemeinsame. Doch die Idee einer europäischen Demokratie bedeutet gerade nicht, dass jemand seine Identität oder Kultur verliert.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Ulrike Guérot.
Europa in 75 Jahren
WirtschaftEine Wirtschafts-Vision für 2095: Wie doch noch vieles gelangWie könnte Europa in 75 Jahren aussehen, wenn wir die richtigen wirtschaftspolitischen Weichen stellen? Rückblick aus einer „ökono-logischen“ Zukunft.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Wilfried Stadler.
Zukunft der Zeitungen
MedienZeitungen: Totgesagte leben länger – und können Zukunft habenZeitungen gehören längst nicht nur geschichtlich zu den Leuchttürmen der Demokratie. Auch wenn immer wieder vom Tod der Printmedien die Rede ist: Das gedruckte Wort ist längst nicht am Ende. Eine Ermutigung.
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Fritz Hausjell.
Interview mit Anton Zeilinger
WissenAnton Zeilinger: „Die Welt ist nicht nur materiell“Anton Zeilinger ist Österreichs populärster Quantenphysiker. Ein Gespräch über Forschungspolitik und Digitalisierung, den chinesischen Weg sowie die Beziehung von Religion und Wissenschaft.
Weiterlesen: Zum vollständigen Interview mit Anton Zeilinger.
Kultur! Eine Ansage.
FeuilletonKultur! Eine Ansage.Kultur ist also nicht systemrelevant. Sie scheint aber sehr relevant für den Menschen. Was bedeutet das, wenn sie nicht mehr relevant ist für das System?
Weiterlesen: Zum vollständigen Text von Brigitte Schwens-Harrant.












































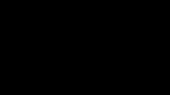



























































 75 Jahre DIE FURCHE
75 Jahre DIE FURCHE
 Segel setzen
Segel setzen
 Die Kunst des Unmöglichen
Die Kunst des Unmöglichen
 Ein Schatz aus 75 Jahren
Ein Schatz aus 75 Jahren
 Koordinaten
Koordinaten
 Van der Bellen: "Nerven bewahren!"
Van der Bellen: "Nerven bewahren!"
 "Haben Sie nicht mit der FURCHE ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich? Wer kann Ihnen ernsthaft Konkurrenz machen? Das stimmt mich optimistisch."
"Haben Sie nicht mit der FURCHE ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich? Wer kann Ihnen ernsthaft Konkurrenz machen? Das stimmt mich optimistisch."
 Liebe Leserin, lieber Leser,
Liebe Leserin, lieber Leser,
 Van der Bellen Teil 2
Van der Bellen Teil 2
 Was gibt Ihnen Orientierung?
Was gibt Ihnen Orientierung?
 Van der Bellen Teil 3
Van der Bellen Teil 3
 "Einmal hat mich eine Botschafterin gefragt: ,Please, explain Austria to me!‘ Und ich habe geantwortet: ,The first thing you have to understand is: Austria is not Germany!"
"Einmal hat mich eine Botschafterin gefragt: ,Please, explain Austria to me!‘ Und ich habe geantwortet: ,The first thing you have to understand is: Austria is not Germany!"
 Van der Bellen Teil 4
Van der Bellen Teil 4
 Ein Tandem für Europa
Ein Tandem für Europa
 Die Krise als Wahrheitsmoment
Die Krise als Wahrheitsmoment
 Die polarisierte Welt
Die polarisierte Welt
 Haben sich die Koordinaten verschoben?
Haben sich die Koordinaten verschoben?
 Rudolf Mitlöhner 1
Rudolf Mitlöhner 1
 Regina Polak 1
Regina Polak 1
 Haben sich die Koordinaten verschoben?
Haben sich die Koordinaten verschoben?
 Haben sich die Koordinaten verschoben?
Haben sich die Koordinaten verschoben?
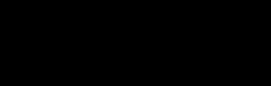 Die Diskutierenden
Die Diskutierenden
 Religionsjournalismus: Wider religiösen Analphabetismus
Religionsjournalismus: Wider religiösen Analphabetismus
 Strömung
Strömung
 Verschwörungmythen: Altes Misstrauen
Verschwörungmythen: Altes Misstrauen
 Gegen den Strom
Gegen den Strom
 Anlegestelle Linz-Urfahr
Anlegestelle Linz-Urfahr
 Zu Tal
Zu Tal
 Zu Berg
Zu Berg
 Wie entsteht eine Strömung?
Wie entsteht eine Strömung?
 "Mit dem Strom gehen heißt an Niveau zu verlieren."
"Mit dem Strom gehen heißt an Niveau zu verlieren."
 Ergänzen nicht bekämpfen
Ergänzen nicht bekämpfen
 Kehrwasser
Kehrwasser
 Gefährliche Unterströmung: Das Unsagbare
Gefährliche Unterströmung: Das Unsagbare
 Frauen in antifeministischen Strömungen
Frauen in antifeministischen Strömungen
 Traditionelle Frauen im antifeministischen Backlash
Traditionelle Frauen im antifeministischen Backlash
 "Machtgewinn durch Selbsterhöhung"
"Machtgewinn durch Selbsterhöhung"
 Edith
Edith
 Hat Feminismus den Anschluss zur Realität verloren?
Hat Feminismus den Anschluss zur Realität verloren?
 Bianca
Bianca
 Jutta
Jutta
 Hausfrau versus Karrierefrau
Hausfrau versus Karrierefrau
 Katharina
Katharina
 Bau-Kulturnation Österreich?
Bau-Kulturnation Österreich?
 Fahrrinnen
Fahrrinnen
 Juden und Muslime: Der mögliche Dialog
Juden und Muslime: Der mögliche Dialog
 Kommen ein Übersetzer, ein Löwe, ein Pudel und ein Philosoph in eine Bar …
Kommen ein Übersetzer, ein Löwe, ein Pudel und ein Philosoph in eine Bar …
 Nicht alle sind WEIRD
Nicht alle sind WEIRD
 Identität: Ein Versteckspiel
Identität: Ein Versteckspiel
 Untiefen
Untiefen
 Ist das Schlamm? Oder lebt das?
Ist das Schlamm? Oder lebt das?
 Chance der Verletzlichkeit
Chance der Verletzlichkeit
 Rassismus in Österreich nach #BLM
Rassismus in Österreich nach #BLM
 Antisemitismus: Es ist nie weg, was einmal war
Antisemitismus: Es ist nie weg, was einmal war
 Wo Europa wegschaut
Wo Europa wegschaut
 Unheilbare Wunden - Flucht und Vertreibung im österreichischen Film
Unheilbare Wunden - Flucht und Vertreibung im österreichischen Film
 Was wir hinnehmen
Was wir hinnehmen
 Ankerplatz
Ankerplatz
 Häfenelegie
Häfenelegie
 Erhard Busek: Heimat als Anker
Erhard Busek: Heimat als Anker
 Können wir noch vertrauen?
Können wir noch vertrauen?
 Intro
Intro
 Vertrauen in der Krise
Vertrauen in der Krise
 Müssen Klienten Ihnen vertrauen?
Müssen Klienten Ihnen vertrauen?
 Vertrauen als Klebstoff der Gesellschaft
Vertrauen als Klebstoff der Gesellschaft
 "Wenn man einem Kind etwas von vornherein nicht zutraut,
"Wenn man einem Kind etwas von vornherein nicht zutraut,
 Vertrauen in der Schule
Vertrauen in der Schule
 Selbstvertrauen und Selbstwert
Selbstvertrauen und Selbstwert
 Die Interviewten
Die Interviewten
 Schule: Ein flirrendes, schwebendes Kollektiv
Schule: Ein flirrendes, schwebendes Kollektiv
 Gehend, steigend, kletternd ankern
Gehend, steigend, kletternd ankern
 Geisteswissenschaft: Die letzte Bastion
Geisteswissenschaft: Die letzte Bastion
 Leuchtfeuer
Leuchtfeuer
 Jürgen Manemann: "Weg mit dem Selbstmitleid!"
Jürgen Manemann: "Weg mit dem Selbstmitleid!"
 Die Natur ist der Schlüssel
Die Natur ist der Schlüssel
 Nach innen Leuchten
Nach innen Leuchten
 Europa: Die Vielfalt der Kulturen und das Sacre du Citoyen
Europa: Die Vielfalt der Kulturen und das Sacre du Citoyen
 Eine Wirtschafts-Vision für 2095: Wie doch noch vieles gelang
Eine Wirtschafts-Vision für 2095: Wie doch noch vieles gelang
 Zeitungen: Totgesagte leben länger – und können Zukunft haben
Zeitungen: Totgesagte leben länger – und können Zukunft haben
 Anton Zeilinger: „Die Welt ist nicht nur materiell“
Anton Zeilinger: „Die Welt ist nicht nur materiell“
 Kultur! Eine Ansage.
Kultur! Eine Ansage.